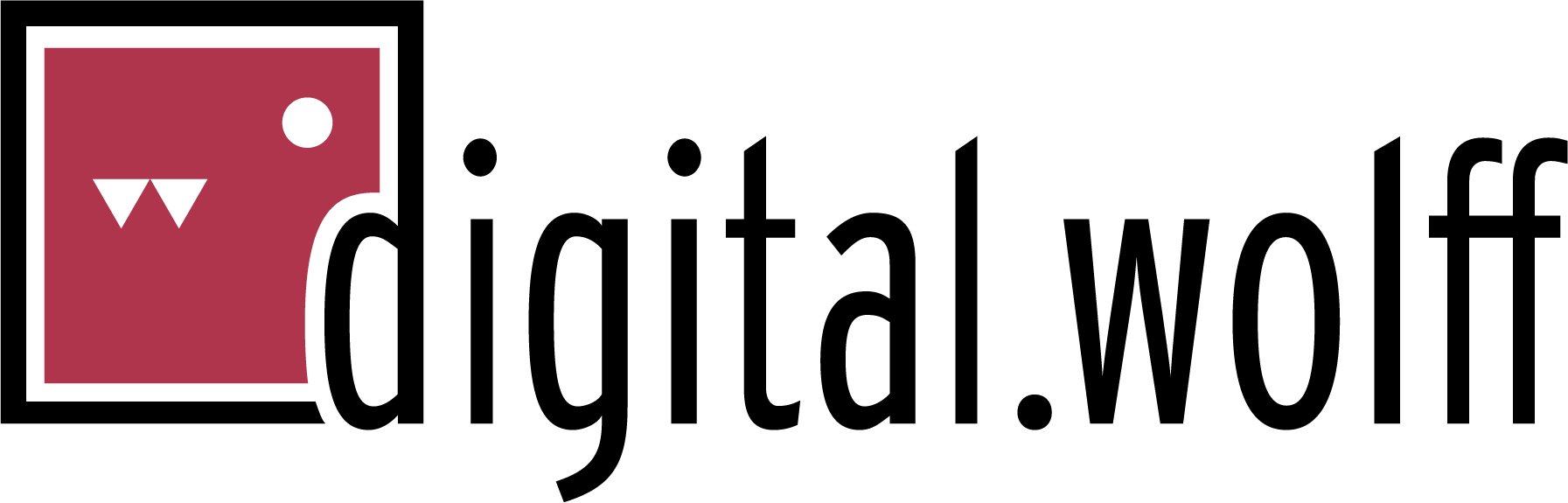Die seit Jahrhunderten bestehende Verschränkung von Zusammengehörigkeit und Identität löst sich allmählich auf. Der Identitätsschwund hängt mit einem Mangel an Zukunft zusammen.
An die Stelle von Herkunft oder gemeinsamen biografischen Merkmalen treten Communitys auf Basis von gemeinsamen Interessen und/oder gemeinsamen Themen. Sie definieren sich ergebnisorientiert und mit Blick auf die Zukunft. Die Zugehörigkeit zu Social-Media-Gruppen ist Ausdruck einer neuen Identitätsbildung.
Die alten Institutionen begegnen dem Schwund an Identität mit der falschen Therapie. Sie folgen ebenso wenig der technologischen Verschiebung in den digitalen Raum, wie sie über den Bestand hinaus eine Zukunftsvision entfalten.
Eine gemeinsame, verbindende Identität schwindet. Dieses Gefühl entsteht beim Blick auf die Mitgliederzahlen der alten Institutionen von Gewerkschaften und Parteien, von Kirchen und Vereinen. Dabei gehört die Identität zum Menschen wie das Fleisch und Blut. Wir können uns einen Menschen und ein Menschenbild ohne Identität noch nicht einmal vorstellen. Vielleicht wäre unsere Vorstellung näher am Tier als am Menschen.
Identität gehört nicht nur zum Menschen, sondern konstituiert ihn überhaupt erst. Die gesamte Erziehung und Bildung zielt auf diesen Prozess, dessen vorläufiger Abschluss die Adoleszenz ist. Und selbst danach findet sich Identitäts- und Charakterbildung als Bestandteil von Ausbildungen. Auf der anderen Seite ist nicht von der Hand zu weisen, wie sehr Identitäten zerfasern oder zumindest unsichtbar werden. Das Bild ändert sich radikal, wenn man einen Blick in die sozialen Medien wirft. Mit wenigen Klicks finden wir Abertausende Gruppen, Kreise und Communitys wieder. Anstelle eines Mangels oder Schwundes beobachten wir eine Fülle von Influencern, Peer Groups und Communitys zu jedem auch nur erdenklichen Thema. Sie alle wirken identitätsstiftend und professionell zugleich.
Den Blick schärfen
Ernest Renan identifizierte für die Nation 1882 zwei Elemente moderner Identität: Erinnerung und Opferbereitschaft (Anmerkung 1 unten). Während des 20. Jahrhunderts wurden allein in Deutschland diverse Identitäten innerhalb der historisch kurzen Periode durchdekliniert: Kaiserzeit, Weimarer Republik, das Dritte Reich, die DDR und BRD hin zum wiedervereinigten Deutschland. In allen war die Steuerung der Identität ein Thema. Die Steuerung von Identität, mit Propaganda assoziiert, war in der liberalen westlichen Nachkriegsgesellschaft in ihrer Wirkung und Wucht unheimlich geworden. Aus Machtversessenheit wurde Machtvergessenheit. Opferbereitschaft für die Gemeinschaft war diskreditiert und aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Die Wahl von Donald Trump holte sie aber schlagartig ins Gedächtnis zurück. Da brachte doch tatsächlich jemand offensiv die schlummernde Identität der US-Amerikaner zum Schwingen. Das ist die Leistung von „America first“ gegenüber dem vorgängigen „Change“. Das eine räsoniert auf die Vergangenheit, das andere auf die Zukunft. Das eine ist pessimistisch, das andere optimistisch.
Damit offenbart sich ein wesentliches Moment von Identität und zugleich von unseren Schwierigkeiten: Die Vergangenheit gilt hierzulande nicht länger als valide Option, ihre Überwindung war und ist das explizite Ideal. Der Witz bringt das auf den Punkt, dass die Deutschen pessimistisch in die Zukunft, während die Österreicher optimistisch in die Vergangenheit blicken. Wenn Vergangenheit konstitutiv für Identität ist, entstehen durch ihren Ausfall erhebliche Schwierigkeiten die Identitätsstiftung. Genau das steckt im Satz von Zvi Rex: Auschwitz würden die Deutschen den Juden niemals verzeihen. Innerhalb dieser historischen Entwicklung verdichtete sich die eingangs genannte Formel der Identitätspolitik. Das Einzige, was von der Herkunft noch übrig ist, sind soziale Widrigkeiten oder illegitime Privilegien. Mithilfe des Fortschritts wird das Problem der Vergangenheit überbrückt und die Ungleichheit durch Herkunft beseitigt. In demselben Maße, in dem die messbaren Erfolge in Form von Lebenserwartung, Gesundheit oder Wohlstand stiegen, stieg auch der Druck einer quälenden Frage: Wofür all das?
Die Zukunft ist also ebenfalls ungeklärt, es fehlt nicht nur an Visionen, sondern überhaupt an Perspektiven. Doch ohne ein Bild der Zukunft lassen sich persönliche und kollektive Opfer nur schwer rechtfertigen. Damit fallen sowohl Vergangenheit als auch Zukunft für die öffentliche Identitätsbildung aus. Der Verdacht drängt sich auf, dass dies der Preis des Fortschritts ist.
Der technologisch induzierte Wandel
Das Thema Identitäten schwand aus dem öffentlichen Bewusstsein, beflügelt vom unendlichen Konsum. Aber es hat in den sozialen Medien neue Entfaltungsmöglichkeiten gefunden, wo es in Form von digitalen Stammtischen aufblüht. Dorthin aber sind die alten identitätstragenden Institutionen von Politik, Kirche und Gewerkschaften nicht gefolgt. In aller Deutlichkeit illustriert das Axel Voss: Als Berichterstatter des EU-Parlaments der Urheberrechtsreform im März 2019 offenbarte er sowohl seine Unkenntnis als auch sein Desinteresse an den Digital Natives. Ein maßgeblicher politischer Akteur zelebrierte sein akutes Desinteresse an den Mechanismen und Orten, in denen sich Identität im 21. Jahrhundert maßgeblich neu organisiert.
Die Dialektik wird sichtbar: Was als öffentlicher Raum schwindet und verschwindet, taucht in den sozialen Medien auf. Jedoch ist das mitnichten wie auf einer guten Party, wo der Partylöwe die Küche verlässt und ins Wohnzimmer geht. Vielmehr verlässt die Party selbst die Feier. Mit anderen Worten, die Öffentlichkeit selbst ändert sich – sie verlässt die (bisherige) Öffentlichkeit und entfaltet sich in einem völlig neuen Raum. Und die alten Institutionen wundern sich, wo die Party hin ist, gleichzeitig weigern sie sich, mitzugehen oder auch nur ein neues Sensorium zu entwickeln. Die wirtschaftlichen Akteure hingegen haben die Veränderungen mitgemacht, frühzeitig die Verlagerung gespürt und dafür die Kompetenzen auf- und ausgebaut. Anders als die politischen, gesellschaftlichen und kirchlich-karitativen Institutionen haben sie verstanden, dass sich die Art der Identitätsbildung selbst verändert hat. Sie wissen um das „Wo“ ebenso wie um das „Wie“. In den sozialen Medien verschmelzen beide Komponenten im Konzept der narrativen Identität.
Narrative Identität
In der Wirtschaft, insbesondere im Marketing, versteht man etwas von narrativer Identität (Anmerkung 2). Dieses Konzept ist eine Frucht des linguistic turn, einer philosophischen Innova- tion des 20. Jahrhunderts. Die Konsequenz liegt in der Entwicklung des Sensoriums für Identitäten, sie zu identifizieren, zu erzeugen und zu steuern. Das wird unter dem Begriff des Storytellings zusammengebracht, einer äußerst erfolgreichen Marketingmethode. Heute findet sich kaum noch ein Produkt, und sei es ein Kuchen, das nicht seine eigene Geschichte hat. Sie wird zum Teil des Konsums und somit zum Teil der Identität des Konsumenten.
Storytelling funktionalisiert eine tieferliegende philosophische Erkenntnis, nämlich dass Erzählungen und narrative Werte Identität nicht nur ausdrücken, sondern den Zugang zu ihrer Gestaltung erschließen. Wenngleich die Ausdrucksmechanismen seit Langem bekannt waren, wurde das Konzept philosophisch erst im letzten Jahrhundert systematisch erschlossen. Eine Identität hat nur, wovon erzählt wird. Jenseits der Erzählung gibt es keine Identität, zumindest keine, von der man weiß. Auf den Punkt gebracht lautet die Erkenntnis: Nicht ein Einzelner erzählt, sondern er wird erzählt. Die Erzählung unterscheidet dabei kaum zwischen Personen und Gruppen, sie behandelt beides auf dieselbe Weise – nämlich als Dinge, die Namen haben. Diesen Namen ordnet sie bestimmte Verhaltensweisen und Werte zu, drückt sie dadurch aus und kann sie auch jeweils neu anordnen. Umgekehrt gilt: ohne Inszenierung keine Identität. Mit diesem Hintergrund erahnt man die tiefe Bedeutung des Befundes, dass es von Europa keine Erzählung gibt. Es wird deutlich: Europa hat keine Identität.
Die intellektuelle Zumutung der narrativen Identität liegt in der Einsicht, dass Mythen und Geschichten mächtiger sind als Logik und Vernunft (Anmerkung 3). Das zeigt sich als Fake News im neuen Gewand: Eine gut erzählte Geschichte schert sich nicht um Fakten, ihr einziges Qualitätskriterium ist die Plausibilität. Man muss akzeptieren, dass Erzählungen, Geschichten und Mythen keine Spielerei sind oder gar die Abwesenheit von Vernunft darstellen, sondern konstitutiv für Identität und somit für Menschen sind.
Der technologische Katalysator
Die technologische Entwicklung katalysiert diese Zusammenhänge. Insbesondere die Erfindung der sozialen Medien greift auf geniale Weise die Mechanismen der narrativen Identität auf. Der Clou liegt darin, dass social media niemals für den Transport von Nachrichten gedacht oder konzipiert wurden. Ihr einziger Zweck liegt darin, zustimmungsfähige Inhalte zu transportieren (Anmerkung 4). Sie zielen auf Emotionen, auf Bedeutung und auf Identität ab. Zustimmungsfähig ist etwas anderes als wahrheitsfähig. Das Bild eines gequälten Tiers wird mit der unausgesprochenen Botschaft versandt: „Du findest das doch auch schrecklich“, und ein „Like“ bestätigt die Zustimmung. Alle, die zustimmen, sind miteinander assoziiert – sie teilen offenkundig einen gemeinsamen Wert. Sie sind auf eine spezifische Weise zusammengehörig und bilden eine nunmehr sichtbare Gruppe. Es geht nicht um Wahrheit oder Falschheit, beziehungsweise Fake, sondern darum, dass jene technisch zusammengebracht wurden, die diesem Merkmal zustimmen. Brauchte Willy Brandts Ausspruch: „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“, noch einen unausgesprochenen, speziellen und historisch gewachsenen Kontext der nationalen Identität, fände er im digitalen Zeitalter eine grundlegendere und unmittelbare Bedeutung.
Entsprechend ist der Vorwurf an die sozialen Medien, sie würden Fake News verbreiten, ungefähr so, als würde man den Papst für das Beten kritisieren. Die Algorithmen sind darauf optimiert, die Funktion der Vernetzung von Gleichem zu erfüllen. Mit anderen Worten: Sie identifizieren anhand von Zustimmung und Ablehnung vorhandene Erzählungen, ergo vorhandene Identitäten – und führen sie dann zusammen.
Die genuin digitale Branche der Computerspiele-Industrie identifizierte frühzeitig eine weitere Facette, nämlich das Community-Management. Sie bezog jene aktiv in die Entwicklung ihrer Spiele ein, die diese Spiele hinterher auch kauften. Jedoch war ihr Community- Management auf ein einziges Merkmal ausgerichtet, nämlich die Lust am Computerspiel. Die sozialen Medien hingegen organisieren die Gesamtheit aller möglichen Merkmale.
Soziale Medien als Brücke zur Entäußerung des Inneren
Die andere geniale Eigenschaft von sozialen Medien liegt in der Visualisierung von Inhalten und Beziehungen. Sie machen sonst Unsichtbares – Beziehungen und Stimmungen, Gruppen und Sympathien – sichtbar. Durch social media braucht man nicht mehr über soziologische Modelle zu spekulieren, sondern kann sie in Echtzeit messen. Sie kehren das Innere der Menschen nach außen. Für jede Stimmung, jedes Ideal und jedes Bedürfnis findet sich unmittelbar ein Bild, ein Video oder ein Meme (aussagekräftige, häufig mit einem Text kombinierte Motive, die sich wie Lauffeuer über das Internet verbreiten).
Die Stammtische sind nicht länger versteckt. Vielmehr bilden sie eine neue Öffentlichkeit, sie sind diese neue Öffentlichkeit. Der Arabische Frühling war Ausdruck ebendieser Innovation, dieser neuen Potenz. Einmal visualisiert und technisch eingebettet, waren die neuen Gruppen ohne weiteres Zutun von selbst organisiert. Der Westen bekam diese Entwicklung erst mit dem Brexit und mit der Wahl von Donald Trump zu spüren. Der Enthusiasmus kippte in demselben Maße, wie die etablierten Institutionen sich angegriffen fühlten und mit Abwehr auf den Machtverlust reagierten.
Verkürzung von Zeit und Raum
Klagen über die schwindende kollektive Identität relativieren sich mit dem Bewusstsein, um welch historisch junge Konzepte es sich überhaupt handelt. Auf den Zusammenhang wies Benedict Anderson hin, indem er von der „Erfindung der Nation“ sprach. Diese Erfindung antwortete auf die zerbröckelnde identitätsstiftende Klammer von Kaiser und Papst im Mittelalter. Im Grunde zeigt sich bei genauer Prüfung, dass eine gemeinsame Identität in der Regel die Folge technologischen Fortschritts war, nicht umgekehrt (Anmerkung 5).
Eine gemeinsame, übergreifende Sprache ist dem Buchdruck zu verdanken – nicht aber einer gemeinsamen Identität. Diese entwickelte sich dann erst in der Folge der gemeinsam vorliegenden Literatur. Der Buchdruck nivellierte die sprachliche Diversität in zwei Dimensionen: In der horizontalen Fläche zwischen den unterschiedlichen Dialekten und vertikal zwischen den sozialen Schichten mit den Latein sprechenden Kosmopoliten des Vatikans auf der einen Seite und den lokalpatriotischen Laien auf der anderen Seite. Auch dass sich die Nation über Landesgrenzen definierte statt über die identitätsstiftende Wirkung des Kaisers ist bereits eine Verschiebung. Das gilt für das „alte“ China ebenso wie für das „alte“ Europa. Der Grund ist ebenso schlicht wie bedeutsam: Technik verbindet, sie verkürzt Wege und sie verkürzt Zeit. Sie rückt alles näher zusammen, bis schlussendlich mit der Digitalisierung alles mit allem vernetzt ist.
Gewichtiger sind die Veränderungen des Zeitverständnisses. Die Aufteilung der Zeit im Mittelalter auf ein Diesseits und ein Jenseits stiftete Identität. Das Diesseits war eine begrenzte Angelegenheit, ein Provisorium: Man lebte auf das Ende der Zeit hin, an dem man vor Gott über seine Taten gerichtet wurde. Mit der Säkularisierung wurde die Begrenzung durch das Jenseits aufgehoben; fortan war aller Sinn im Diesseits zu suchen. Das „Ende der Zeit“ durch die Apokalypse verkehrte sich in eine endlose Zeit. Wir sehen heute die Erde als ein Schiff, das die Menschheit durch die unendliche Zeit und den un- endlichen Kosmos trägt. Das verbindet zur Identität „Menschheit“, unterminiert umgekehrt aber die lokalen Zusammengehörigkeiten. Es wäre verkürzt, das nur als Globalisierung zu denken. Vielmehr ist es ein Ergebnis des technologischen und zivilisatorischen Fortschritts, mit dem die Menschen aus den althergebrachten Bindungen gelöst werden.
Tatsächlich misst sich der technologische Fortschritt selbst grundlegend in der Zeitersparnis, die er bringt. Was einst für ein ganzes Leben reserviert war, ist heute ein Lebensabschnitt von vielen (Anmerkung 6). Drückte sich die berufliche Identität der Eltern maßgeblich in der Namensgebung „Müller“ oder „Bäcker“ aus und übertrug sich auf das Selbstverständnis der Kinder, werden heutzutage mühelos diverse Ausbildungen und Berufe innerhalb von Lebensabschnitten durchschritten. Technologischer Fortschritt widmete sich konsequenterweise der Messung von Zeit, die möglichst überall gleich sein sollte. Der Eisenbahnverkehr war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Treiber eines gemeinsamen, Kontinente und Orte übergreifenden Zeitverständnisses. 1893 wurde die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) als Normalzeit in ganz Deutschland eingeführt, sodass an jedem Bahnhof dieselbe Uhrzeit galt, um die Ankunft und Abfahrt der Züge zu koordinieren.
Die optimistische Zukunft
Wurden also die Institutionen des Mittelalters immer mit dem Blick auf das Ende der Zeit errichtet, finden wir uns mit Hegels und Fukuyamas „Ende der Geschichte“ in einer unbegrenzten Zeit und völligen Offenheit der Zukunft gegenüber. Diese Offenheit, die immer auch Freiheit bedeutet, blicken die Menschen ratlos an – und sie blickt ebenso ratlos zurück. Über uns findet sich der Himmel mit seiner Vollzähligkeit der Sterne, der uns mit der ebenso großen Vielzahl quälender Möglichkeiten konfrontiert. Die unbegrenzte Zeit und Offenheit muss irgendwie gefüllt werden. Die Frage lautet schlicht: Wie? Welche Identität lohnt sich zu verfolgen, die zumindest ansatzweise über die hedonistische Bedürfnisbefriedigung im Konsum hinausgeht?
Es sind Fragen oder – präziser – Stimmungen von Optimismus und Pessimismus. Gegenwärtig dominiert im Westen der Pessimismus. Die Science-Fiction-Serien von Star Trek dokumentieren das gut. Die Serie Star Trek: The Next Generation der 1980er- Jahre zeigte den Optimismus. Das zukunftszugewandte Bild zeichnete eine verheißungsvolle, gewaltfreie und diplomatische Zukunft. Die Grundstimmung war neugierig und vorfreudig. Seit 2017 schauen wir in der aktuellen Serie Star Trek: Discovery dem Pessimismus bei der Arbeit zu. Keine Folge ohne Explosionen, Gewalt und Zerstörung. Alles Morgen ist düster, alle Hoffnung richtet sich auf militärische Überlegenheit.
Strategischer Umgang mit Identität
Identität löst sich aus den historischen Bedingungen. Sie entfaltet, technologisch unterstützt, eine neue soziale Wirklichkeit. War Zusammengehörigkeit historisch nach Örtlichkeit organisiert, erleben wir nun Zusammengehörigkeit nach Interesse. Freiheit und Zugehörigkeit fallen nicht länger auseinander, sondern die Zugehörigkeit zu Social- Media-Gruppen ist Ausdruck einer neuen Identitätsbildung. Hinter dieser Qualität von Freiheit gibt es kein Zurück. Entweder lassen sich die alten Institutionen auf diese neue Wirklichkeit ein, oder in dieser werden ihrerseits neue Institutionen ausprägt. Dabei darf man die Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit nicht überschätzen, denn sie geht nicht länger mit der Bereitschaft nach Verbindlichkeit einher. Soziale Mobilität gelangt in einem digitalen Raum ohne Entfernungen zu einem Höhepunkt (Anmerkung 7).
Daraus lassen sich einige Gedanken ableiten: Das Privileg und die Hoheit, von der Identität zu erzählen und sie somit zu organisieren, liegt nicht länger bei den alten Institutionen. Vielmehr wurde dieses Privileg gleichermaßen kommerzialisiert und dezentralisiert. Wie in der Wirtschaft schon geschehen, wird die Kompetenz für Narrative und Erzählungen zum kleinen Einmaleins, das man entwickeln, pflegen und anwenden muss. Je weniger es sich dabei um ein bloß funktionelles Storytelling handelt, sondern um eine tatsächlich zukunftsorientierte Erzählung, desto erfolgreicher wird sie sein. Es wird zur Pflicht, vorhandene Erzählungen zu kennen. Möchte man beispielsweise ein gemeinsames Europa, muss man die Narrative der einzelnen Nationen kennen und ihr gleichberechtigtes Nebeneinander grundlegend akzeptieren (Anmerkung 8).
Für den strategischen Anspruch bedeutet die Kenntnis der Narrative nur die Grundlage, um sie selbst zu erzählen. Die hohe Kunst liegt dann darin, eine Erzählung in unterschiedlichen Milieus, Gruppen und Communitys zu erzählen. Das aber ist die Pointe der sozialen Medien: Weil dort Erzählungen in Echtzeit Resonanz finden, sind sie mit geringem Aufwand in kürzester Zeit so weit aufgeladen, dass den handelnden Akteuren nach und nach die Kontrolle entgleitet. Ist man anfangs noch in der Lage, ein Narrativ zu steuern, ändert sich das rasch. Dann ist das Narrativ selbst dasjenige, welches Möglichkeiten eröffnet oder Beschränkungen auferlegt. Die Erzählung „erzählt“ sozusagen aus sich selbst heraus, die vormaligen Akteure werden zu fremdbestimmten Elementen dieser Erzählung.
In einem größeren Umfang gewinnen jene, die einen plausiblen Zukunftsentwurf anbieten. Ob optimistisch oder pessimistisch, ist nachrangig – auch wenn Optimismus natürlich schöner ist. Denn eben das eint Trump, Brexit und AfD: Immerhin haben sie irgendeine Zukunftserzählung. In der politischen Landschaft jenseits des Kalten Krieges ist das zur Rarität geworden. Solange nicht gemeinsame kollektive Erfahrungen in Form von Katastrophen oder Zwangssituationen ihre eigenen identitätsstiftenden Furchen hinterlassen, wird es um die Orchestrierung der vielen Partikularidentitäten gehen, die aber alle eine gemeinsame Resonanz aufweisen. Damit wird Community Management zur Königsdisziplin des politischen Handwerks.
Anmerkung 1: „Das eine ist der gemeinsame Besitz eines reichen Erbes an Erinnerungen, das andere ist das gegenwärtige Einvernehmen, der Wunsch, zusammenzuleben. Eine Nation ist also eine große Solidargemeinschaft, getragen von dem Gefühl der Opfer, die man gebracht hat, und der Opfer, die man noch zu bringen gewillt ist.“ Ernest Renan, „Was ist eine Nation?“, in: Michael Jeismann, Henning Ritter (Hrsg.): Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus. Reclam 1993, S. 290–311.
Anmerkung 2: In seiner Gänze entwickelte Paul Ricœur das Konzept der narrativen Identität als Abschluss und Höhepunkt seines dreibändigen Werks Zeit und Erzählung, im Original: Temps et récit, Bd. III. Fink, München 2007, S. 389 ff.
Anmerkung 3: Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. Suhrkamp 2001; Wilhelm Schmidt-Biggemann: Apokalypse und Philologie. V&R 2007, insb. S. 357 ff.
Anmerkung 4: Daniel Suarez: „Wie Technologie unser Denken beeinflusst“, in: re:claim autonomy!, 2016, http://schirrmacher-symposium.de.
Anmerkung 5: Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Campus 1988, S. 30 ff., 44 ff.
Anmerkung 6: Hans Blumenberg: Schriften zur Technik. Suhrkamp 2015, S. 270.
Anmerkung 7: So sehr, dass Sven Hillenkamp analysiert, wie Freiheit und Glück nun auseinanderfallen. Sven Hillenkamp: Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeitalter unendlicher Freiheit. Klett-Cotta 2010.
Anmerkung 8: Ausstellungsband Mythen der Nationen. Deutsches Historisches Museum 2004. In dem Band werden jeweils fünf Gründungsnarrative von 18 europäischen Nationen nebeneinander vorgestellt.
Die Originalversion wurde in „Nachhaltige Kommunikation in unübersichtlichen Zeiten“ publiziert. Herausgeber: Dr. Hans-Peter Canibol, Susanne Theisen-Canibol. Mit Beiträgen von: Dr. Kurt E. Becker, Matthias Dezes, Alexander Engelhardt, Dr. Claudia Mauelshagen / Susanne Theisen-Canibol, Ingrid Schneider / Claudine Villemot-Kienzle, Dr. Martin C. Wolff.